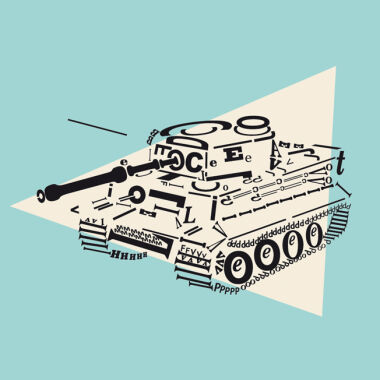»Anfangs hatte Mutter noch Brot, das sie von zu Hause heimlich mitgenommen hatte. Aber bald war es verzehrt und ich konnte es nicht verstehen, dass davon nichts mehr geblieben war. Wenn ich zu Hause Hunger hatte, nahm Mutter den Laib aus der Tischlade und schnitt mir ein Stück ab. Ich konnte auch nicht verstehen, dass wir uns fürs Essen anstellen und warten mussten. Ich wehrte mich sehr dagegen, aber NSV-Schwester Elfriede, die für Ordnung sorgte, trennte mich rücksichtslos von Mutter und stellte mich in die Reihe, wo auch die übrigen Kinder auf die Kost warten mussten. […] Das Essen war nicht gut. Alles schmeckte bitter oder war ungesalzen, nur der Salat war gezuckert, was mir und auch allen anderen nicht schmeckte. Die Suppe, eine schwarze Brühe, mochte ich überhaupt nicht. Ich ließ sie in der Schüssel stehen, bis es eines Tages Schwester Elfriede bemerkte. Sie stellte sich an unseren Tisch, beobachtete mich und ließ mich so lange nicht aus den Augen, bis ich die grausige Suppe, die schon kalt geworden war und so noch grausiger schmeckte, ausgelöffelt hatte.«